Netzkulturförderung Marke „Eigenbau“. Die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Fördermodelle. Die Funktionsweise von Netzkultur entzieht sich der klassischen Vorstellung von Kultur. Räume, Projekte, Rezeption und Präsentation werden neu definiert und hybridisiert. Die Netzkultur in bestehende Förderschemata zu pressen konnte daher immer nur als Zwischenlösung gesehen werden. Es ist höchste Zeit, über neue Fördermodelle nachzudenken.
Die derzeitige Situation ist insofern unbefriedigend, weil sie weder die Bedürfnisse von Institutionen noch von Einzelkünstlerinnen ausreichend berücksichtigt. Ohne Künstlerinnen sind Institutionen zwecklos und dienen meist nur dem Selbsterhalt.
Andererseits benötigen Künstler auch Institutionen, um Aufmerksamkeit für ihre Themen und Projekte zu erzeugen, eine Öffentlichkeit zu erreichen und um an notwendige Infrastrukturen für ihre Projektarbeit zu kommen. Institutionen und Projekte stehen nicht – wie gerne von der Kulturpolitik suggeriert – in Widerspruch und Konkurrenz, sondern in einem konstruktiven, einander bedingenden Verhältnis zueinander. Wenn man die Netzkultur nachhaltig fördern möchte, muss sich dieses Verhältnis in der Fördervergabe widerspiegeln.
Demnach ist es Aufgabe der Kulturpolitik, gemeinsam mit allen Akteurinnen geeignete Konzepte zu entwickeln, die eine langfristige Entwicklungsperspektive für Institutionen und Künstlerinnen eröffnen. Der in Wien eingeschlagene Weg erfüllt keine dieser Forderungen.
Sicher, das traditionelle Fördersystem ist wenig geeignet, Netzkultur adäquat zu erfassen und zu unterstützen. Die Einbindung von Beiräten und Expertinnen hat gezeigt, dass in den vergangenen Jahren diese Probleme nur kaschiert wurden, anstatt sie mit allen Betroffenen zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. Die Privatisierung der Fördermittelvergabe löst aber keine Probleme, sondern schiebt sie von Politik und Verwaltung zu den Fördernehmern selbst, ohne diesen die Möglichkeiten zu geben, die Rahmenbedingungen zu verändern. In Wien zeigt sich das auf eindrucksvolle Weise.
Mana als falsche Antwort auf die richtige Frage
Kritiker haben schwere Vorwürfe gegen das System Mana erhoben. Auf formaler Ebene ist der wohl gravierendste die vermutete Verfassungswidrigkeit des Systems. Niemand der Verantwortlichen hat es bis heute als notwendig erachtet, auf den Vorwurf der Grundrechtswidrigkeit einzugehen, wobei dies dringend notwendig wäre.
Ein von der IG Kultur in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten1 zieht sowohl die Transparenz als auch die Nachvollziehbarkeit des neuen Fördersystems Mana in Zweifel. Ein Punkt, der nicht nur juristisch von Bedeutung ist, sind doch viele Aspekte des Systems nach wie vor unklar. Aber auch abseits juristischer Bedenken lässt sich einiges zu Mana anmerken.
Grundsätzlich ist der völlige Rückzug der Kulturpolitik aus der Entscheidungsfindung zu kritisieren, da sie damit jegliche Verantwortung für getroffene Entscheidungen von sich weist. Im neuen Modell entscheiden nun die Fördernehmer selbst, welches Projekt wie viel Geld erhalten soll.
Stimmen Medienkünstler und Netzaktivisten über die Verteilung von Fördergeldern ab, so werden aus Fördernehmern Fördergeber, die damit in einen unauflösbaren Konflikt zwischen kulturpolitischen und persönlichen Interessen gedrängt werden. Wenn sich die Fördernehmer gegenseitig Gelder zuteilen, hat das nichts mit Partizipation oder Demokratie zu tun. Es ist sogar ein Mechanismus, der dazu geeignet ist, demokratische Kontrollen und Regulative auszuhebeln.
Weiters sind die Richtlinien zur Fördervergabe in wesentlichen Bereichen unklar – woraus sich ergibt, dass die Fördernehmer in ihrer Rolle als Fördergeber nur ungenaue Vorstellungen ihrer Verantwortung entwickeln können. Es bedürfte der klaren Formulierung eines politischen Willens, was warum gefördert wird, um Nachvollziehbarkeit und Transparenz für die Fördernehmer zu schaffen. Diese Formulierung darf keinesfalls der Kulturpolitik überlassen bleiben, sondern muss von den Aktivistinnen und Künstlerinnen formuliert werden. Fehlt aber eine solche grundsätzliche Übereinkunft, besteht die Gefahr, dass das System in Beliebigkeit abgleitet.
Ein inhaltlicher Schwachpunkt ist auch die Reduktion des gesamten Sektors auf einzelne Projekte mit beschränkter Laufzeit. Die Schaffung von Infrastruktur ist zwar grundsätzlich möglich, der Betrieb und die damit entstehenden Kosten unterliegen aber keiner regelmäßigen Evaluierung, sondern dem Zwang neuer Einreichungen und Abstimmungen, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist. Zudem schließen die maximal ausgeschütteten Summen und das Entscheidungsverfahren mittelfristige Planbarkeit aus – unter diesen Umständen Infrastruktur betreiben zu wollen ist ein Hazard-Spiel. So wichtig eine ausreichende Projektförderung für die Netzkultur auch ist, so kann sie doch nicht die Schaffung und den Betrieb von Strukturen ersetzen.
Zurück an den Start
Der derzeit in Wien stattfindende Prozess deckt viele Schwierigkeiten auf, Netzkunst und Netzkultur ähnlich wie andere Kultursparten zu behandeln. Es wäre besser gewesen, die Politik hätte sich mit diesen Problemen auseinandergesetzt, als sie an diejenigen weiterzureichen, die von ihrer Lösung eigentlich profitieren sollten. Stattdessen müssen nun all jene, die für ihre Arbeit Unterstützung durch öffentliche Mittel suchen, die Qualität der anderen bewerten – und diese Bewertung hat klare Auswirkungen auf deren Produktionsbedingungen und gegebenenfalls auch auf deren Existenz: Wer nicht gewählt wird, bekommt kein Geld. So einfach kann Demokratie sein.
Statt das Feld zu räumen sollte die Kulturpolitik ihre Verantwortung übernehmen und in einer öffentlichen Debatte ein neues Förderkonzept für die Netzkultur entwickeln, das neue Entwicklungen unterstützt ohne notwendige Strukturen zu zerschlagen. (Sarah Schönauer, Peter Riegersperger)
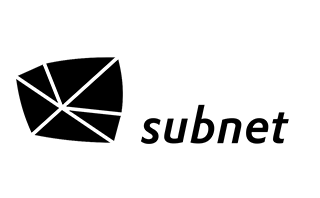
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.